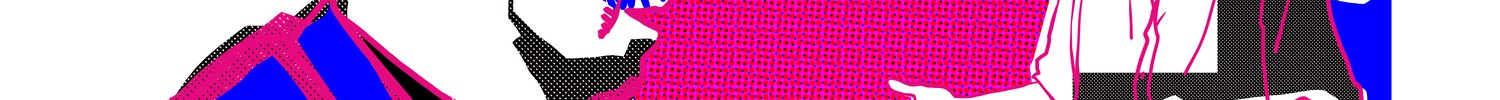Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis 2020 geht an Michael Roes
Der vom LWL vergebene und mit 12.800 Euro dotierte Annette von Droste-Hülshoff-Literaturpreis geht an Michael Roes.
Im Herbst 2020 entstand ein halbstündiges Video, in dem Michael Roes dem LWL-Direktor und dem Paderborner Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Nobert Otto Eke ausführlich über seine schriftstellerische Arbeit Rede und Antwort stand. In Zentrum stand dabei das für Roes' zentrale Moment des Reisens, das den Hintergrund seiner Romane, Gedichte und Filme bildet. Außerdem sind Kurzlesungen des 1960 in Rhede, Kreis Borken, geborenen Preisträgers in das Filmportrait eingeflochten, das auf diese Weise einen unmittelbaren Eindruck seiner Texte vermittelt.
Den Film können Sie auf dieser Seite ansehen, sowie die Gespräche noch einmal in schriftlicher Form nachlesen.
In der Begründung der Droste-Jury hieß es: „Michael Roes' 13 Romane, aber auch seine Film- und Theaterarbeiten haben die Literatur um neue Themen bereichert. Sie bringen den Lesern fremde Lebens- und Kulturkreise auf eindringliche Art und Weise nahe.“ Roes habe hierfür offene, multiperspektivische Erzählformen gefunden, die immer auch die Perspektive des „Anderen“ einschließen.
Roes lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin.
Der LWL und die Literaturkommission gratulieren nochmals herzlich und bedauern sehr, diesen fröhlichen Anlass nicht, wie geplant, mit einem angemessenen Festakt begehen zu können.
Michael Roes im Interview
Hier können Sie das voraufgezeichnete Gespräch des Preisträgers Michael Roes mit LWL-Direktor Matthias Löb und Prof. Dr. Norbert Eke ansehen.
Weiter unten finden Sie die Gespräche zum Nachlesen oder hier als PDF zum Download.
Michael Roes im Interview mit Landesdirektor Löb
Löb: Herr Roes, mit dem Annette von Droste-Hülshoff-Preis wird Ihnen ja der westfälische Literaturpreis verliehen. Den bekommen Sie natürlich für Ihr Werk, aber Anknüpfungspunkt ist eben auch Geburt und Aufwachsen im Münsterland. Ist Ihnen das eher unangenehm, daran erinnert zu werden?
Roes: Nein, absolut nicht, eher wundere ich mich, dass ich erst sechzig werden musste, aber Sie wissen ja: Der Prophet im eigenen Land ... Das ist tatsächlich der erste Preis, den ich hier aus meiner Heimatregion bekomme, und das freut mich sehr.
L: Und dieses Zurückkommen nach Westfalen jetzt, wie ist das für Sie?
R: Ich bin ja nicht aus Westfalen geflohen. Irgendwohin aufzubrechen, in meinem Fall nach Berlin, heißt ja nicht, von irgendwo vertrieben worden zu sein. Wenn überhaupt, dann ist es das Elternhaus, das mich hat fortgehen lassen. Meine Heimatregion habe ich eigentlich immer geliebt, deswegen ist es für mich auch sehr berührend, wieder hier zu sein. Mit dem zeitlichen und räumlichen Abstand sehe ich nun auch andere Seiten meiner Herkunft, die frühe Verletzungen oftmals überdeckt haben.
L: Sie haben ja gerade das Wort Heimat verwendet. Ihr Roman Zeithain beginnt mit einem Fontane-Zitat: „Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen“. Was heißt für Sie Heimat?
R: Ich bin sehr zurückhaltend bei der Verwendung des Begriffs Heimat. Mein Zuhause ist Berlin, und das ja seit über vierzig Jahren. Aber ich kann durchaus etwas anfangen mit Fontanes Zitat. Ich glaube, die Fremde lehrt uns weniger, was unsere Heimat ist, als vielmehr, wer wir selbst sind. Dazu muss man die Heimat verlassen, denn im Selbstverständlichen ist man sich selbst einfach zu selbstverständlich. Um wahrzunehmen, wer ich bin, muss ich mich mit den Augen von Fremden wahrnehme. Das ist im Grunde die tiefste Erfahrung all meiner Reisen: Dass ich mich selbst neu erfahre vor allem viel über mich lerne.
L: Bevor wir zu Ihren Reisen kommen: Als was sind Sie denn unterwegs, wenn Sie reisen, als Literat, als Philosoph, als Anthropologe?
R: Es kommt auf die Projekte an. Wenn ich an einem Werk wie Rub‘ al-Khali arbeite, dann bin ich gewiss auch als Anthropologe oder Ethnograph unterwegs. Wenn ich einen Film drehe, bin ich Regisseur. Das Gemeinsame ist, dass ich in der Fremde immer der Fremde bin, subjektiv scheinen alle anderen fremd zu sein, aber alle anderen sind ja dort Zuhause, ich hingegen bin der Zugereiste, der Exot. Das touristische Reisen ist natürlich anders, da ist man dann doch oft wieder im Vertrauten. Aber wenn ich zum ersten Mal in einem abgeschiedenen Dorf im Jemen bin, in dem noch nie zuvor ein Europäer war, dann bin ich der absolute Fremde, dann zählt erstmal auch nicht, warum ich da bin. Man beginnt am Nullpunkt der Begegnung, und dieser Nullpunkt ist auch der Beginn, wo ich mich zum ersten Mal radikal neu erfahre. Dass wir uns selbst so vollkommen fremd sind, das geschieht nur in einer Situation, in der ich für alle anderen der ganz Andere bin.
L: Das hat ja erstmal etwas Positives, wenn Sie sagen, ich erkenne mich in den Augen der anderen selbst besser. Aber Sie schreiben im Leeren Viertel auch, Reisen sei immer auch ein bisschen Flucht aus der Kultur, aus der man komme. Vor wem oder was laufen Sie dann sozusagen weg?
R: Ich habe immer versucht, mich nicht selbst zum psychoanalytischen Objekt zu machen. Es gibt auch ein Wissen über sich, das es einem unmöglich macht, noch darüber zu schreiben. Das Schreiben braucht eine gewisse Unschuld oder Naivität, zumindest das Schreiben über sich selbst. Jetzt, im Rückblick, ist mir schon klar, dass ich mich bereits hier, Zuhause, in der Heimat, als Fremder wahrgenommen habe.
L: Sie beschreiben ja sich selbst als Völkerkundler, als Anthropologe, und Sie sagen, das ist jemand, der aus seiner eigenen Kultur fliehe, in eine andere Kultur komme und erwarte, dass man ihn dort „durchfüttere“. Und das Durchfüttern, so verstehe ich das, meint ja vor allem die Teilhabe an der anderen Kultur. Und man hat den Eindruck, wenn man Ihre Werke liest, dass Ihnen im großen Maße die Türen auch aufgetan werden. Wie schaffen Sie das?
R: Völkerkundler, Feldforscher, Ethnologe, das sind inzwischen absolut fragwürdige Begriffe. Die Ethnographie war ja immer auch, ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt, die Avantgarde des Kolonialismus. Erst kamen die Ethnographen, haben das Feld sondiert und die Karten gezeichnet, dann kam das Militär und die europäische Landnahme. Im Leeren Viertel habe ich das Zwiespältige an der ethnographischen Neugier bereits sehr kritisch reflektiert: Ist es legitim, was ich hier mache? Wofür mache ich das? Welchen Sinn hat das? Deswegen würde ich heute keinen dieser Begriffe mehr für mich benutzen. Ich bin ein Schriftsteller, der unterwegs ist, und möglicherweise ist ein guter Schriftsteller ja auch ein guter Ethnograph. Und umgekehrt.
Der zweite Aspekt, diese vollkommene Abhängigkeit, in der sich Ethnologen ja in der klassischen Ethnographie immer wieder begeben haben, in ein unsicheres, zum Teil gefährliches Feld, vollkommen angewiesen auf die Gastfreundschaft ihrer Gastgeber, das ist tatsächlich ein Fall für die Psychoanalyse, diese totale Regression: Man kann nicht überleben, ohne dass die anderen sich kümmern. Alle Souveränität, alle Autonomie lässt man zurück, im Urwald oder in der Wüste gibt es ja kein Restaurant, kein Café, keinen Arzt, rein gar nichts. Ohne die Hilfe und Fürsorge der Einheimischen kann der Fremde nicht überleben. Welche psychische Konstitution braucht es, als gestandener Akademiker, als Wissenschaftler sich diese existentiellen Abhängigkeiten zuzumuten? Ich reflektiere diese Fragen im Leeren Viertel, ohne darauf die Antworten zu wissen. Aber Sie sprechen auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an.
L: Aber vielleicht darf ich da trotzdem nachhaken. Die Gegenwartsebene im Leeren Viertel befasst sich mit einem Forscher, der Formen des Spiels zusammenträgt. Ich habe mir beim Lesen hin und wieder gedacht: Da stellt ein europäischer Universalgelehrter Fragen, die die Einheimischen sich wahrscheinlich nie selbst stellen würden. Wie reagieren die einheimischen Kulturen auf solche Fragen?
R: „Die Einheimischen“ gibt es nicht. Die Menschen dort sind in ihren Unterschieden genauso vielfältig wie hier. Auch hier würden viele nicht wirklich begreifen, warum ein erwachsener, akademisch gebildeter Mann sich zum Beispiel mit Kinderspielen beschäftigt. Überraschend war für mich eher, dass ich selbst im abgelegensten Dorf Menschen fand, die ich wirklich im weitesten Sinne Intellektuelle nennen würde, Menschen, die neugierig waren, Fragen stellten, die bereit zu einer Art Perspektivwechsel waren, verstehen wollten, Menschen, ohne die ich meine Arbeit nicht hätte machen können. Oftmals waren es die Dorfschullehrer, aber nicht selten einfach junge Leute, die auf mich zugegangen sind, wissen wollten, wer ich bin, und vermittelt haben, also nicht nur übersetzt, sondern auch fremde Begriffe und Konzepte derart in das Eigene, Vertraute übertragen haben, dass ihre eigenen Leute es verstehen und annehmen können. Schon einen Begriff wie „Spiel“ so zu übersetzen, dass er nicht nur mit Kindheit, Unernst und Zeitvertreib konnotiert wird, ist eine hohe intellektuelle Kunst.
Diese Art von Klugheit, von wirklicher Seelenbildung habe ich immer gefunden. Wo kommt das her, dass jemand, der nie sein Dorf verlassen hat, sofort auf einen zugeht und fragt, wer man sei, und sich über nichts wundert, sondern erstmal alles spannend findet? Es ist diese Empathie, diese fast körperliche Zuneigung, die den anderen wirklich verstehen will, die ein Aufeinandertreffen von Fremden erst zu einer wahren Begegnung macht. Wenn ich sie nicht mitbringe und bei den anderen nicht finde, kann ich an diesem fremden Ort nicht bleiben, sondern muss fortgehen. Auch diese Erfahrung musste ich schon machen. Ohne Neugier und Zuneigung bleibt die Fremdheit unüberbrückbar.
L: Lassen Sie uns über den literarischen Schaffensprozess bei Michael Roes sprechen. Wie entstehen Ihre Ideen für Ihre Projekte, Ihre Bücher? Lesen, hören Sie über irgendein Land und sagen „Ach, da wollte ich auch mal hin“ oder stolpern Sie bei Ihren Recherchen über einen interessanten Stoff, und sagen sich, „mit dem wollte ich mich schon immer einmal befassen“?
R: Ich will jetzt nicht allzu romantisch klingen, aber fast alle Projekte in den letzten vierzig Jahren gehen auf Ideen zurück, die bereits am Beginn meines Schreibens vorlagen. Alles war mit achtzehn, zwanzig Jahren schon da, zum Beispiel die Katte-Tragödie. Mit zwanzig wusste ich bereits, dass ich irgendwann den maßgeblichen Katte-Roman schreiben werde. Mir war auch klar, dass ich ihn nicht gleich schreiben kann, sondern mir dazu erst mal das nötige Handwerkszeug erarbeiten muss. Als ich im letzten Sommer noch einmal meine frühen Notizbücher durchgegangen bin, tauchten alle meine Arbeit bestimmenden Themen schon auf, so Pasolini, dessen Tod ich in einem frühen Theaterstück dramatisiert habe und der im letzten Roman Herida Duro erneut eine wesentliche Rolle spielt und mich in vielfältiger Hinsicht während meines ganzen Arbeitslebens begleitet und beeinflusst hat. Es gibt zweifellos Lebensthemen, die in Variationen immer wieder auftauchen, vielleicht sogar gewisse Obsessionen. Es reicht jedenfalls nicht zu sagen, das klingt ja interessant, ich mach mal was dazu. Es ist eher das Abarbeiten eines Lebensplans, der immer schon irgendwie da war.
L: Die Antwort überrascht mich. Ihre Persönlichkeit entwickelt sich ja weiter, es passieren neue Dinge um Sie herum, ist da noch Raum für Unvorhergesehenes, für neue Stoffe?
R: Selbstverständlich. Ich glaube, es gäbe gerade dann keinen Raum für Unvorhergesehenes, wenn es nicht dieses Skelett, dieses Grundgerüst gäbe. Erst dieser Rahmen erlaubt es mir, das Chaos an Ideen und Möglichkeiten in mir zu bändigen und dafür eine Form zu finden. Wenn ich ohne eine konkrete Vision an ein neues Werk heranginge, würde ich in der Fülle und der Beliebigkeit des Materials ertrinken. Man könnte ja unendlich an demselben Werk weiterarbeiten und es mit der eigenen Entwicklung immer wieder neu schreiben, und es gibt ja tatsächlich auch Autoren, die ihr Leben lang an dem einen Text gesessen und ihn nie zu Ende gebracht haben, weil sie keine abschließende Vorstellung von ihrem Werk hatten.
L: Viele Leser fragen sich bei Ihren Romanen sicherlich, was ist Fakt und was ist Fiktion? In Zeithain zum Beispiel finden sich die Briefe von Katte an seine Tante Melusine. Gibt es dafür, tatsächlich Dokumente, die Ihnen als Vorbild gedient haben, oder ist es reine Fiktion?
R: Ich bin sehr skeptisch, was den Begriff Fakten angeht, aber genauso skeptisch, was die Fiktion betrifft. Beim Schreiben geht es mir eher um Plausibilität. Wenn ich gefragt werde: Gibt es diese Briefe wirklich?, heißt das vor allem, ich habe sie so plausibel gestaltet, dass man sich das fragen kann. Natürlich gibt es Hintergrundrecherchen, in denen ich versuche, die Geschichte so nah ans Faktische heranzubringen, dass sie glaubwürdig wirkt. Wenn ich das Leben in London Anfang des achtzehnten Jahrhunderts schildere, darf es darin keine Brücke über die Themse geben, die erst Jahre später gebaut wurde. Wichtiger aber ist die Imagination des Schriftstellers, die, bei den großen Autoren zumindest, weit über das Faktische hinausgeht. Wenn Dostojewski über die russische Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts schreibt, frage ich nicht, ist das alles wirklich so passiert; nein, da ist die Sensibilität dieses Autors und seine gestalterische Kraft, die soviel mehr zu erzählen weiß, als uns jedes Faktum berichten könnte. Und das gilt natürlich auch für meinen Katte: ich weiß nicht, ob alles wirklich so passiert ist, aber es hätte so passieren können. Und am Ende geht es ja nicht um eine Katte-Biographie, sondern es geht um eine exemplarische Tragödie, die uns bis heute angeht und berührt.
L: Sie haben dreizehn Romane geschrieben und viele weitere Werke, Essays, Streitgespräche, Filme geschaffen. Wie schafft man es, so produktiv zu sein?
R: Für mich stellt sich eher die Frage, wie schaffe ich es, mal nicht produktiv zu sein? Ich bin ein zwanghafter Arbeiter und kann konstitutionell nicht nichts tun. Das Nichtstun macht mich buchstäblich krank. Das Schreiben hingegen bedeutet Lebenssinn und Lebensglück, es ist ein lebensnotwendiger Teil meines Alltags, so wie das Aufstehen, Essen und Atmen.
L: Das heißt, Routinen sind für Sie ganz wichtig?
R: Ich würde es eher Rituale nennen, denn Routinen gibt es im dichterischen Schaffen nicht.
L: Ihre Romane, Ihre Bücher, die sind nicht immer leicht zugänglich, sie sind komplex, oft ausufernd. Waren Sie schon mal in der Versuchung zu sagen, jetzt schreibe ich einen Roman, der linear, auf einer zeitlichen Ebene erzählt wird und der sich dann wahrscheinlich auch besser verkaufen würde?
R: Tatsächlich höre ich gelegentlich, nicht nur von Lesern, sondern auch von Verlagen, schreib doch mal so oder so. Aber so geht das natürlich nicht, außerdem liebe ich die Literatur zu sehr, um mich von solchen „Versuchungen“ korrumpieren zu lassen.
L: Sie haben gerade kurz das Verhältnis zwischen Autor und Verlag gestreift. Gibt es denn im aktuellen Literaturbetrieb etwas, das Sie gern ändern würden, wenn Sie es ändern könnten?
R: Wir sind gerade in einem solchen Umbruchprozess, dass ich gar nicht vorhersagen kann, was in zwanzig Jahren noch von der Buchkultur, wie wir sie kennen, übrig ist. Aber es betrifft mich dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass es das Buch in seiner haptischen, anfassbaren Form noch gibt. Ich bin nicht gut im digitalen Lesen, ich muss ein richtiges Buch in der Hand halten. Ich schreibe auch noch mit der Hand. Jeder Fortschritt hat seinen Preis. Mit den Erleichterungen, die uns die Digitalisierung beschert, geht zum Beispiel der Verlust der klassischen Archive gehen verloren. In meinen Manuskripten findet man unter dem Durchgestrichenen immer noch die erste Idee.
L: Themenwechsel. Mich würde Ihr Menschenbild interessieren. In vielen Ihrer Werke thematisieren Sie Strukturen, die Minderheiten unterdrücken, Sie prangern Ausgrenzung und Diskriminierung an. Sind Sie ein politischer Autor? Sind Ihre Texte politisch, zielen sie also auf die Veränderung von Gesellschaft ab?
R: Selbstverständlich sind meine Texte politisch. Ob sie gesellschaftlich auch etwas verändern können, darf zumindest beim Schreiben nicht im Vordergrund stehen. Aber ich will schon neue Perspektiven in meine Arbeit bringen und Minderheitspositionen einnehmen. In fast in allen Romanen gibt es nur die Ich-Perspektive, kein allwissender Erzähler schaut mit göttlichem Blick auf alles und in alle hinein, sondern individuelle Menschen sprechen, dadurch ergibt sich ein polyphoner Klang unterschiedlichster Stimmen. Das ist vielleicht die tiefste erreichbare Veränderung: die Identifikation des Lesers mit unüblichen Helden, das Hineinversetzen in jemanden, der ich selbst nicht bin, denen Gehör verschaffen und für jene Empathie zeigen, die man sonst nicht hört.
L: In Haut des Südens zum Beispiel nehmen Sie eine sehr dezidierte Position ein, und ich habe das Gefühl, es ist auch ein gewisser Zorn, der Sie treibt.
R: Ja, darin findet sich eine Amerika-Erfahrung, die aktueller gar nicht sein könnte. Es ist ein frühes Werk, das von der Gegenwart einmal mehr eingeholt worden ist, und ja, da gebe ich Ihnen recht, Haut des Südens ist ein zorniges Buch und hat daher auch einigen Widerspruch einstecken müssen. Psychologisch ist das sicher nicht sehr geschickt, aber ich denke, gelegentlich ist es geradezu notwendig, auch mal zornig zu sein, vor allem wenn es um Rassismus, Homophobie oder Frauenverachtung geht.
L: Ich finde, ein Schriftsteller darf auch leidenschaftlich sein. Sind Sie ein Mensch, der lieber alleine ist, oder der auch mal gerne in Gesellschaft geht?
R: Ich komme gut mit mir alleine klar, ja, ich bin lieber mit mir alleine als in anstrengender Gesellschaft. Was ich nicht gut ertrage, ist Smalltalk; je größer eine Gruppe ist, desto mehr verflacht das Gespräch. Aber ich bin durchaus ein dialogischer Mensch, der sich gerne mit guten Freunden und anderen klugen Menschen unterhält. Und wenn es nötig ist, kann ich mich während einer Zugfahrt auch mit einem Hertha-Fan über Fußball unterhalten.
L: Aber, um noch einmal auf den Aspekt des Reisens zurückkommen, da müssen Sie, wenn Sie eine fremde Kultur kennenlernen wollen, ja oft den ersten Schritt machen und auf den Fremden zugehen.
R: Ja, aber das sind meistens keine Gruppen, sondern Einzelne, so wie ich in der Regel auch nur als Einzelner angesprochen werde. Bin ich in einer Gruppe, wird niemand von sich aus auf mich zugehen. Begegnet man mir alleine, vielleicht auch noch mit der sichtbaren Hilflosigkeit des Fremden, dann gibt es immer jemanden, der darauf reagiert und seine Hilfe anbietet. Und oft ergeben sich aus diesem ersten Schritt dann sogar tiefe und lang anhaltende Freundschaften. Am Anfang gibt es auf beiden Seiten sicher eine Scheu, aber diese Scheu ist ja auch ein Zeichen des notwendigen Respekts.
L: Ich möchte noch einmal kurz beim Menschenbild verweilen. Wenn ich Ihre Bücher lese, würde ich sagen, ohne Frage, Michael Roes ist ein Menschenfreund. Dann aber lese ich in einem Werk den Satz, dass der Mensch tugendhaft nur dann sei, wenn es ihm nütze.
R: Das ist in jeder Hinsicht zu platt gedacht. Verhalten ist immer komplex; einiges ist uns bewusst, einiges sicher unbewusst. Ich glaube, es ist gut, einige Motive unseres Verhaltens auch fremd, auch unbewusst zu belassen und unsere oder die Geste des anderen so anzunehmen, wie wir sie einander entgegenbringen, ohne sie in all ihren Aspekten zu analysieren. Die großartige Gastfreundschaft der Beduinen zum Beispiel ist Teil ihrer Kultur und vollkommen unabhängig von der eigenen Motivation, sie unterliegt keiner Wahl. Natürlich kann man den Gast auch in einer unwilligen Stimmung empfangen, aber die Gastfreundschaft selbst wird nicht in Frage gestellt. Und auch ich fange dann nicht an, über unlautere Motive nachzudenken. Ich folge einfach meiner Intuition, denn ich weiß, dass ich den Anderen oder auch die andere Kultur niemals restlos verstehen kann.
L: Abschließende Frage: Was würden Sie einem jungen Menschen entgegnen, wenn dieser zu Ihnen käme und Ihnen sagte, er wolle Schriftsteller werden?
R: Ich würde ihm sagen, das sei nichts, was man werde, sondern etwas, das man sei. Es gibt so viele Phasen im Künstlerdasein, wo man an sich, seiner Arbeit oder der mangelnden Anerkennung verzweifeln würde, wenn man diese Gewissheit, nichts Anderes sein zu können, nicht hätte.
Michael Roes im Interview mit Prof. Dr. Eke
Eke: Herr Roes, ich habe in Ihrem letzten Buch Melancholie des Reisens einen wunderbar rätselhaften Satz gefunden, den ich gern zum Auftakt dieses Gesprächs zitieren würde. Dort heißt es: „Die großen Werke sind jene, die etwas Wesentliches verbergen. Und das Verbergen zeigen.“ Das steht hier in Abgrenzung gegenüber dem Tagebuch. So ein Tagebuch, schreiben Sie hier, sei kein eigentliches Werk, und das eigentliche Werk habe ein Geheimnis. Was soll ein Werk verbergen und gleichzeitig zeigen?
Roes: Jetzt haben Sie die Antwort ja schon vorweggenommen. Ich glaube, genau darum geht es, um ein Geheimnis, man könnte auch sagen, einen Bereich, den nur der Leser füllen kann. Es braucht diesen Raum, in dem nicht alles zu Ende formuliert, zu Ende gedacht ist … Nun, vielleicht zu Ende gedacht, aber nicht ins Werk gefasst, einen Spielraum für die eigenen Fantasien, Projektionen, Weiterdichtungen des Lesers. Bei einem Tagebuch hingegen denkt der Autor den Leser nicht mit. Die Kunst der Moderne aber kennzeichnet, dass das Werk nicht vollendet ist, dass es fragmentarisch und brüchig bleibt und Leerstellen lässt und den Leser oder Betrachter dazu auffordert, ein aktiver Rezipient zu sein.
E: Das passt zu einem Satz von Gottfried Benn, ich glaube, er hat das in seiner Büchner-Preisrede gesagt. Darin geht es um die Kunstwerke, die lebendig bleiben. Das seien jene, die Unruhe stifteten, die brüchigen und zerbrochenen Werke. Bei allen anderen sei der Sargdeckel der Klassizität drauf. Erst die Toten sagt Benn hier, hätten es es gut; ihr Werk sei zur Ruhe gekommen und leuchte „in der Vollendung“.
R: Ja, das offene Kunstwerk erlaubt uns, es immer wieder neu zu lesen und in jedem neuen Kontext auch neu zu verstehen, genau weil es diese Leerstellen, diese Geheimnisse hat.
E: Welche Rolle spielt denn der Leser dabei? Ich habe in Melancholie des Reisens auch eine anderslautende Aussage gefunden: Das Werk sei nicht für den Leser, sondern es sei erst einmal für sich da.
R: Die Melancholie des Reisens ist ein besonderer, ein in vieler Hinsicht hybrider Text, der keinem eindeutigen Genre angehört. Darin mischen sich Tagebuchfragmente mit essayistischen Passagen, die natürlich einen Adressaten haben, aber nicht selten dem Tagebuch widersprechen. Auch das scheint mir ein Kriterium für das moderne, offene Kunstwerk zu sein, die Widersprüchlichkeit, weil sie für unterschiedliche Perspektiven steht. Viele meiner Texte erzählen ihre Geschichte ja von vornherein aus verschiedenen Erzählperspektiven. Diese widersprüchlichen Ich-Erzähler finde ich auch in mir. Deswegen wundert es mich nicht, wenn ich zwei Seiten später auf das Gegenteil dessen stoße, was ich zwei Seiten zuvor behauptet habe.
E: Nun hat diese Essay-Sammlung, die zum Teil ja auch Vorlesungen gewesen sind, selbst wieder einen rätselhaften Titel: Melancholie des Reisens. Da werden zwei Begriffe zusammengebracht, die auf den ersten Blick nicht zusammenzugehören scheinen. Der Melancholiker ist ja jemand, der sich der objektlosen Trauer hingibt, die allein in ihm begründet zu sein scheint; mit Melancholie verbindet sich zunächst einmal eher ein Zustand oder ein Zeitmodus der Passivität, der Zeitlosigkeit, der langen Weile. Ich rede jetzt nicht von Langeweile, sondern der langen Weile, wie man im 18. Jahrhundert gesagt hat. Der Melancholiker ist in seiner Schwermut zu Hause. Reisen dagegen ist ein Bewegungsmodus, ist Bewegung in Raum und Zeit, ist Aufbruch, ist Verlassen des Raums der eigenen Gebundenheit. Wie passen die beiden Begriffe zusammen?
R: Sie haben meine Antwort einmal mehr in Ihre Frage gepackt. Was im Titel vielleicht tatsächlich widersprüchlich wirken könnte, erklärt sich in den Essays. Am Ende des Buches wird es den Leser nicht mehr wundern, dass hier eben nicht der vorwärtsdrängende, hyperaktive, die Fremde erobernde Reisende unterwegs ist, an den man womöglich zunächst denkt, sondern wirklich ein Melancholiker, ein passiver, abwartender, fast masochistischer Reisender, der seine Reisen eher erleidet. In der Melancholie ist nicht vom Reisen generell die Rede, sondern von einem ganz spezifischen Reisenden mit einer ganz eigenen Art von Sensibilität, ein Reisender, der nicht aufgeht in dem, was er bereist, sondern mit einer gewissen Widerspenstigkeit, auch und gerade körperliche Art, unterwegs ist. Daraus ergeben sich besondere Konflikte und eben das Material, das der Reisende, der Autor für seine Arbeit sucht. Die Reflektion braucht genau diese Distanz, diesen Abstand auch zu sich selbst. Jemand reist, der eigentlich gar nicht reisen will. Im Leeren Viertel war es bereits der Aufklärer Schnittke, der im Grunde gar nicht zum Reisen geschaffen war, aber dann der Einzige von seiner Reisegruppe ist, der die Expedition in den Jemen überlebt. Genau dieses Nicht-dazu-geschaffen-sein erlaubt ihm, mit der nötigen Distanz das zu reflektieren, was ihm widerfährt, weil ihm dauernd der eigene Körper in die Quere kommt und zur notwendigen Assimilation an die Fremde zwingt.
E: Melancholie ist nicht nur reine Schwermut, das haben Sie in Ihrer Antwort schon mit gesagt, sie hat auch eine Kehrseite. „Komm, heilige Melancholie“, hat Ludwig Völker vor vielen Jahren einmal eine wunderschöne Anthologie deutscher Melancholie-Gedichte überschrieben (was natürlich ein Zitat ist). Es gibt hier meines Erachtens eine Verbindung zwischen Reisen, Schreiben und Melancholie, über die ich gerne noch weiter reden möchte. Sie haben jetzt gesagt, Sie seien ein schwermütiger Reisender. Wie geht das mit der Literatur zusammen? Die Reisen, die Sie unternommen haben, sind ja in der Regel anlassbezogen, und am Ende steht meistens auch ein literarisches Werk. Können Sie zu diesem Zusammenhang vielleicht noch etwas sagen?
R: Zu den beiden Begriffen Melancholie und Reisen gehört ein dritter, nämlich das Lesen. Ich glaube, der Melancholiker ist jemand, der die Fremde liest, der sie nicht gestalten will und sich von ihr nicht gestalten lässt, sondern der sie wie ein Buch aufschlägt und sich bestenfalls von ihr fesseln lässt. Das Lesen ist sowohl eine Aktivität als auch ein Erleiden oder eine Hingabe, wir überlassen uns dem Buch und den Räumen, in die der Autor uns führt, sind aber ganz aktiv in dem Schaffen von Bildern, Personen, Topographien. Auch der Melancholiker ist oftmals jemand, der einfach nur dazusitzen und zu schauen scheint, nicht aktiv eingreift in das, was er wahrnimmt, sondern zunächst versucht, es zu verstehen. Das ist erst mal meine Art, wie ich der Fremde begegne, lesend. Ich kann mir auch andere Formen vorstellen, und die finden ja auch bei mir gelegentlich statt, zum Beispiel wenn ich einen Film drehe, ein Stück inszeniere oder unterrichte. Dann sitzt da natürlich nicht der schwermütige Melancholiker im Regiestuhl und lässt geschehen, sondern da gibt es dann durchaus den energischen Regisseur, der aktiv eingreift und gestaltet. Aber die Momente, in denen ich am meisten erfahre, von mir und den anderen, sind jene, in denen ich mich selbst am meisten zurücknehme.
E: Dieses Beisichsein halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt in Ihrem Werk, denn der Reisende, das reisende Ich in Ihren seit nun über dreißig Jahren geschriebenen Romanen erfährt nicht nur die Fremde, sondern er erfährt vor allem auch sich selbst. Und der Modus der Selbstbeobachtung ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Bücher. Stets tritt der Beobachtung die Selbstbeobachtung an die Seite, dem Außen gleichsam das Innen.
R: Ja, das gilt sicher für die meisten meiner Bücher, auch wenn die früheren Reisen gezielt für ein Werk und auf ein Werk hin unternommen wurden. Bei Melancholie des Reisens ist es insofern anders, weil hier nun wirklich der Reisende selbst in den Mittelpunkt gestellt ist. Man erfährt relativ wenig über die Fremde, es ist kein klassischer Reiseführer über einen besuchenswerten Ort, es ist ein Buch über einen Reisenden. Mir war es wichtig, einmal den Reisenden selbst ins Zentrum zu rücken, da er ja derjenige ist, durch den der Leser die Fremde erfährt. Je weniger er vom Erzähler weiß, desto undurchsichtiger ist eigentlich alles, was er von ihm erfährt. Aber wenn er die Brille kennt, durch die der Reisende auf das Bereiste blickt, kann der Leser auch beurteilen, wie subjektiv das alles ist, was im Text beschrieben wird.
E: Sie haben vorhin in der Kapelle der Burg Hülshoff aus dem frühen Gedichtband Durus Arabij, Arabische Lektionen, gelesen, in dem die Begegnung mit dem anderen, mit der Fremde, auch schon in der Sprache anwesend ist, die Gedichte sind zum Teil in arabischer Sprache verfasst, was Hybridität sinnlich erfahrbar werden lässt. Wenn Sie die Zeitspanne von diesem frühen Werk bis hin zur Melancholie des Reisens überschauen, hat sich für Sie die Erfahrung des Anderen, des Fremden geändert? Und hat das Reisen den Reisenden, den Schriftsteller Michael Roes, verändert?
R: Ich habe diesen Corona-Sommer genutzt, noch weiter zurückzugehen, nämlich zu den Anfängen meines literarischen Schreibens, in die Lehrzeit, die Jahre noch vor jeder Veröffentlichung, und ich war vollkommen überrascht, wie viel von den Motiven, Themen, und Obsessionen schon von Anfang an vorhanden ist. Eigentlich ist der ganze Roes in diesen frühen Arbeiten schon präsent, aber natürlich auch noch ganz viel Wut, Bitterkeit, adoleszente Aufgeregtheit. Mit dem Älterwerden gehen dann selbstverständlich Reifungsprozesse einher, und es wäre fatal, wenn sie sich nicht auch im Schreiben widerspiegelten. Sicher reise ich inzwischen anders. Zunächst einmal reise ich nicht mehr so viel und nicht mehr so weit, aber auch das, was ich dort, in der Fremde, suche, hat sich verändert. Glücklicherweise habe ich in den Jahren, in denen ich noch jung genug dazu war, all jene Dinge zu realisieren versucht, zu denen ich damals noch die Kraft hatte, meine Filmprojekte zum Beispiel. Auch wenn dann einiges gescheitert ist, bin ich doch froh, nichts aufgeschoben zu haben, obwohl oft alle Umstände gegen die Verwirklichung sprachen. Nichts von dem würde ich jetzt noch nachholen können oder auch nur wollen. Aber viele der früheren Reisen und der daraus entstandenen Werke waren nur möglich auf Grund jugendlicher Radikalität und Unvernunft, die damals noch bereit war, für ein Werk das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.
E: Ich will die Frage noch mal ein bisschen zuspitzen. In der Melancholie des Reisens bin ich auf folgende Bemerkung gestoßen: Es gehe nun nicht mehr darum, die Fremde, das Andere verstehen, sondern es zulassen zu wollen. Hier verwandelt sich der Impuls zum unbedingten Verstehenwollen in etwas, was Sie die „Achtung des Nichtverstehens“ nennen. Ich sehe darin i eine entscheidende Entwicklung, einen großen Wandel im Werk.
R: Was ich tatsächlich vollkommen abgelegt habe, ist jeder Eroberungsgedanke, vielleicht sogar die Absicht oder der Wunsch, das Fremde in seiner ganzen Tiefe verstehen zu wollen, denn auch dieser Wunsch enthält noch eine Eroberungsabsicht. Was ist das auch für eine Anmaßung zu glauben, mit Sensibilität, Klugheit oder strategischem Geschick könnte man den Anderen vollkommen durchschauen! Das ist nun gewiss schon ein Stück Altersgelassenheit, dieser Anmaßung eine Absage zu erteilen und die Fremdheit einfach zuzulassen. Das gilt nicht nur für das geographisch Fremde, sondern für jedes menschliche Miteinander: Den anderen sein zu lassen, auch und gerade in dem, was ich nicht verstehe, das Nichtverstehen aushalten zu können und trotzdem miteinander befreundet zu sein. Es ist das gute Recht des Anderen, (s)ein Geheimnis zu wahren, es ist eine Form des Respekts, ihn nicht in allem verstehen, nicht durchschauen zu wollen. Ich kann und will ihn nicht zwingen sich mir ganz und gar zu öffnen und fände es inzwischen auch für uns beide ganz schrecklich, einander nackt gegenüberzustehen.
E: Kommen wir noch mal zu den Anlässen für die Reisen und die unterschiedlichen Theater- und Filmprojekte zurück. Es gibt gegen diese Art des Kunstmachens den Vorbehalt, da komme jemand mit der europäischen Tradition, mit seiner eigenen Kultur und pfropfe diese einer anderen Kultur ein. Also Kolonialismus im kulturellen Feld. Sie haben sich dagegen sehr stark verwehrt und vorhin auch ein kleines Stückchen aus dem Lob des Bastards gelesen, wo Sie auf solche Kritik antworten. Wenn ich diesen Text richtige verstehe, ist der Bastard für Sie so etwas wie der Virus des Lebendigen im Gehäuse der kalten Kulturen. Etwas, wo Utopie ansetzt, wo Reibung entsteht und wo aus der Reibung heraus etwas Neues erwächst.
R: Besser kann ich es auch nicht formulieren. Das wäre dann das nächste Attribut für meine Definition der Moderne, nämlich das Hybride, die Bastardisierung. Ich glaube, dass gerade da, wo Dinge nicht zusammenpassen, wie im Titel des letzten Buchs, sich eine kreative Spannung ergibt und aus diesem Widerspenstigen tatsächlich Neues erwächst. Das gilt nicht nur für die Kunst, das gilt auch für alle gesellschaftlichen Prozesse. In der Kritik des postkolonialen Diskurses an interkulturellen Projekten steckt wiederum eine absolute Arroganz, als gäbe es nicht in allen Kulturen Gruppen von Intellektuellen und Künstlern, die genau diesen Austausch, diese Hybridisierung wollen und suchen. Hier macht sich die Kritik gemein mit einer konservativen, beharrenden Mehrheit, die von kultureller Reinheit schwadroniert und jede Art von Bastardisierung, nicht nur in der Kunst, bekämpft. Aber wir Künstler können uns diesem Reinheitswahn natürlich nicht anschließen, denn die Kunst beginnt genau da, wo sie sich in Widerspruch setzt. Wenn wir da einer verharrenden, konservativen Mehrheit entgegenkommen, vermeintlich aus Respekt, dann lassen wir natürlich die Fremden, die Intellektuellen, die Künstler in jenen Gesellschaften vollkommen im Stich, denn diese Freiheit zur Grenzüberschreitung und Vermischung ist auch ihr täglicher Kampf. Sie ringen um dasselbe wie die Künstler hier. Sie stellen sich in Widerspruch zu ihrer Gesellschaft und versuchen etwas Neues, begegnen aber einem wesentlich stärkeren Druck von Seiten ihrer Regime und vielleicht auch von der Mehrheit ihrer Landsleute. Für mich als Künstler ist ganz klar, dass ich diese Kritik, diesen angeblich die kulturelle Reinheit und am Ende doch nur das „gesunde Volksempfinden“ oder die Machteliten schützenden Diskurs infrage stelle. Ich kenne genug Künstlerkollegen, die an derselben Front kämpfen und die mich bitten: Lasst ihr uns nicht auch noch im Stich! wenn ich mich von den Einwänden einschüchtern lasse und meine Projekte schließlich doch nicht mit ihnen zusammen realisiere.
E: Das ist auf einer kulturtheoretische Ebene sehr nachvollziehbar. Am Schluss von Rub‘ al-khali steht eine Tanzszene, in der alles endet: Tanz ist Poesie, Tanz ist Sprung durch, ist Bewegung in Raum und Zeit, aber vor allen Dingen: Tanz erlaubt Begegnung ohne und jenseits der Sprache; auf der Ebene des Körpers. In diesem Zusammenhang fällt dieser wunderbare Satz, ein Schlüsselsatz zum Verständnis Ihres Werkes, über Fremdheit und Gemeinsamkeit. Wir sind einander fremd, haben unterschiedliche Kulturen und reden in unterschiedlichen Sprachen, aber wir haben eins gemeinsam, und das ist der Körper: „Doch können wir uns verständigen. Denn gemeinsam haben wir unseren Körper.“ Das heißt also, der Körper ist das Habitat des Utopischen, das Sie jetzt mit der Bastardisierung auch kulturtheoretisch begründet haben. Welche Rolle spielt für Sie da der Körper, die Körperlichkeit, die ja eine enorme Präsenz in Ihren Werken hat?
R: Es gibt einfach menschliche Erfahrungen, körperliche Erfahrungen, die wir alle miteinander teilen, also Urerfahrungen, über die wir uns nicht erst verständigen müssen. Wir haben alle eine Kindheit hinter uns, haben ähnliche Ängste und Abhängigkeiten erlebt, sind durch Erziehungsprozesse gegangen. Natürlich, alle diese Prozesse sind bereits mit einer spezifischen Kultur verbunden, es gibt keine reinen, von Kultur unbeeinflussten Körper. Aber wir alle teilen diese frühen, elementaren Erfahrungen, Hunger, Hilflosigkeit, Geborgenheit ... Und diese elementare, körperliche Ebene ist es doch auch, auf der wir uns zunächst begegnen. Der erste Blick, eine halbe Sekunde, und wir wissen, ob uns jemand sympathisch ist oder nicht. Etwas hat sich zwischen uns bereits verständigt, ehe wir überhaupt das erste Wort miteinander wechseln. Wenn jemand uns unsympathisch ist, kommt es zu diesem ersten Wort womöglich erst gar nicht. Und umgekehrt, wenn jemand meine Neugier weckt, schaffe ich es sogar, eine gemeinsame Sprache zu erfinden, auch wenn der andere eine Fremdsprache spricht. Auf meinen Reisen gab es viele Situationen, wo wir uns nicht verbal verständigen konnten, aber aufgrund gegenseitiger Empathie, das wäre hier das Schlüsselwort, nach Verständigungsmöglichkeiten gesucht haben. Der Auslöser ist ja zunächst immer die körperliche Begegnung und der Wunsch, vielleicht könnte man sogar sagen, das Begehren: Ich möchte dich verstehen, und ich möchte von dir verstanden werden. Es sind, glaube ich, ganz essentielle und letztlich körperliche Gründe, die zur Verständigung führen oder ihr natürlich auch im Weg stehen können.
Selbstständige Publikationen von Michael Roes
Nicht nur die oben erwähnten Titel hat Michael Roes verfasst. Im Folgenden finden Sie eine Liste seiner selbstständigen Publikationen.
Aufriss. Bad Homburg: Hunzinger 1990
Tischsitten. Bad Homburg: Hunzinger 1991
Jizchak. Versuch über das Sohnesopfer. Berlin 1991 [Diss.]; Berlin: Parthas 2005
Cham. Ein Symposion. Berlin: Gatza 1993
Lleu Llaw Gyffes. Roman. Berlin: Gatza 1994
Rubʿ al-Khali. Leeres Viertel. Frankfurt a.M.: Eichborn 1996; Berlin: Matthes & Seitz 2010
Durus arabij. Arabische Lektionen. Gedichte. Frankfurt a.M.: Eichborn 1997
Der Narr des Königs. Madschnun al-Malik. Ein Schelmenstück in sieben Aufzügen nebst einem Vorspiel und sechs Verwandlungen. Frankfurt a.M.: Eichborn 1997
Der Coup der Berdache. Roman. Berlin: Berlin-Verl. 1999
Haut des Südens. Eine Mississippi-Reise. Berlin: Berlin-Verl. 2000
David Kanchelli. Roman. Berlin: Berlin-Verl. 2001
Nah Inverness. Roman. Berlin: Parthas 2004
Kain. Elegie. Berlin: Parthas 2004
Weg nach Timimoun. Roman. Berlin: Matthes und Seitz 2006
Perversion und Glück. Berlin: Matthes & Seitz 2007
Krieg und Tanz. Reden – Gespräche – Aufsätze. Berlin: Matthes & Seitz 2007
Ich weiß nicht mehr die Nacht. Roman. Berlin: Matthes & Seitz 2008
Die fünf Farben schwarz. Roman. Berlin: Matthes & Seitz 2009
Geschichte der Freundschaft. Roman. Berlin: Matthes & Seitz 2010
Engel und Avatare. Ein Dialog über reale und virtuelle Welten. Berlin: Matthes & Seitz 2011 [zus. mit Hinderk Emrich]
Die Laute. Roman. Berlin: Matthes & Seitz 2012
Der eifersüchtige Gott. Ein Gespräch. Aschaffenburg: Alibri 2013 [zus. mit Rachid Boutayeb]
Die Legende von der Weißen Schlange. Roman. Berlin: Matthes & Seitz 2014
Einige widersprüchliche Anmerkungen zur Vergeblichkeit der Liebe. Ein Gespräch. Aschaffenburg: Alibri 2015 [zus. mit Hinderk Emrich]
Zeithain. Roman. Frankfurt a.M.: Schöffling & Co. 2017 [Rez.: 1. A. Kahrs, in: Altmark-Blätter vom 02.12.2017, S. 192; 2. C. Eger, in: Mitteldeutsche Zeitung vom 19.02.2018, S. 23]
Der Körper des Fremden. Freiburg: modo 2018 [Ausstellungskatalog, zus. mit Markus Daum]
Peripherie. Freiburg: modo 2018 [Ausstellungskatalog, zus. mit Markus Daum]
Herida Duro. Roman. Frankfurt a.M.: Schöffling & Co. 2019
Melancholie des Reisens. Frankfurt a.M.: Schöffling & Co. 2020